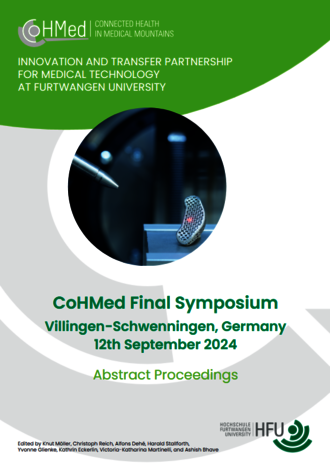
Erkenntnisse aus dem CoHMed-Final Symposium
Künstliche Intelligenz, personalisierte Implantate und digitalisierte Operationssäle verändern grundlegend, wie Diagnosen gestellt und Behandlungen durchgeführt werden. Die Veröffentlichung der CoHMed Final Symposium Abstract Proceedings, die im Dezember 2024 als Open-Access-Publikation erschienen ist, bietet spannende Einblicke in die moderne Medizintechnik. Die Publikation geht aus dem Link öffnet sich im gleichen Fenster:CoHMed-Abschlusssymposium am 12. September 2024 in Villingen-Schwenningen hervor und enthält 25 wissenschaftliche Artikel mit Projektergebnissen der geförderten CoHMed-Projekte.
Die Forschungs- und Transferinitiative Connected Health in Medical Mountains (CoHMed) wurde von der Hochschule Furtwangen ins Leben gerufen und über neun Jahre hinweg vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Ziel war es, Wissenschaft und Industrie enger zu verknüpfen und Innovationen in der Medizintechnik zu fördern. Insgesamt wurden 20 Forschungsprojekte mit 34 Forschungspartnern aus der Industrie – darunter 21 kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) – mit einem Gesamtvolumen von 11 Mio. Euro durch das BMBF gefördert. Die Ergebnisse von CoHMed sprechen für sich: über 500 wissenschaftliche Publikationen, vier Erfindungen und zahlreiche praxisnahe Lösungen, die die medizinische Versorgung der Zukunft prägen werden.
Forschungsschwerpunkte der Publikation
Die Abstract Proceedings, herausgegeben von Prof. Dr. Knut Möller (HFU), Prof. Dr. Christoph Reich (HFU), Prof. Dr. Alfons Dehé (Hahn-Schickard), Dr. Harald Stallforth (TechnologyMountains), Yvonne Glienke (MedicalMountains), Kathrin Eckerlin (HFU), Viktoria-Katharina Martinelli (HFU) und Ashish Bhave (HFU), präsentieren eine Vielzahl innovativer Projekte. Die dokumentierten Forschungsarbeiten decken ein breites Spektrum ab, von denen hier einige interessante Schwerpunkte exemplarisch vorgestellt werden:
Intelligente Implantate und Materialwissenschaft
Die Entwicklung autarker, intelligenter Implantate wird von Prof. Dr. Ulrich Mescheder (HFU), Prof. Dr. Volker Bucher (HFU), Sonja Müller (HFU) und Daniel Sauer (HFU) erforscht (S. 2–3). Diese Implantate sind mit energieautarken Sensoren ausgestattet und passen sich adaptiv an individuelle Patientenbedürfnisse an. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Langlebigkeit von Implantaten ist die Materialwissenschaft. Die Forschergruppe um Lena Burger (HFU), Prof. Dr. Sven Ulrich (Karlsruher Institut für Technologie) und Prof. Dr. Hadi Mozaffari-Jovein (HFU) untersuchte, wie die Mikrostruktur von additiv gefertigtem Titan (Ti-6Al-4V) das Ermüdungsverhalten beeinflusst – ein essenzieller Faktor für die langfristige Haltbarkeit dieser Implantate (S. 6–7).
KI-gestützte Bildverarbeitung und digitale Endoskopie
Die Optimierung der medizinischen Diagnostik durch künstliche Intelligenz ist ein weiteres zentrales Thema der Proceedings. Algorithmen zur KI-gestützten Bildverarbeitung, entwickelt von Ning Ding, Dr. Jan Stodt, Tamer Abdulbaki Alshirbaji, Prof. Dr. Christoph Reich und Prof. Dr. Knut Möller (alle HFU), verbessern nicht nur die Diagnostik, sondern berücksichtigen auch regulatorische Anforderungen für die Zertifizierung medizinischer Produkte (S. 4–5).
Mit dem MiniLiVE-Projekt setzen Horim Bae (Universitätsmedizin Göttingen) und Prof. Dr. Mike Fornefett (HFU) neue Maßstäbe in der Endoskopie (S. 10–11). Sie entwickelten ein miniaturisiertes, drahtloses Videoendoskop, das die Bildgebung während minimalinvasiver Eingriffe erheblich verbessert.
Intelligente Chirurgie und Digitalisierung des OPs
Ein weiterer innovativer Beitrag stammt von Jack Wilkie und Prof. Dr. Knut Möller (beide HFU), die einen smarten Schraubendreher entwickelt haben. Dieses System gibt individuelle Drehmomentempfehlungen und trägt so zu einer präziseren Platzierung chirurgischer Schrauben bei, wodurch das Risiko von Komplikationen reduziert wird (S. 12–13). Das Projekt DACAPO verknüpft Echtzeit-Sensordaten mit KI-Analysen, um chirurgische Abläufe zu optimieren. Diese Technologie könnte dazu beitragen, Operationen effizienter zu gestalten und potenzielle Fehler zu minimieren (S. 19–20).
Fazit
Die in den CoHMed Final Symposium Abstract Proceedings dokumentierten Projekte verdeutlichen, dass die Zukunft der Medizintechnik in interdisziplinärer Zusammenarbeit, technologischer Innovation und praxisnaher Forschung liegt. CoHMed setzt damit neue Maßstäbe für eine fortschrittliche und patientenorientierte Gesundheitsversorgung. Mit der bevorstehenden Verstetigungsphase wird dieser Weg konsequent fortgesetzt, um nachhaltige Forschungsstrukturen zu etablieren und den Transfer innovativer Lösungen in die medizinische Praxis weiter zu stärken.
Download